
Statt eines Vorwortes
 »Die Herrschaft modernisiert sich auf allen Ebenen: Der Kapitalismus startet
durch und betreibt ein Rollback sozialer Absicherungen, das Patriarchat
propagiert den Backlash, Nationalismus und Rassismus scheinen ebenso wie
Militäreinsätze der "Weltmacht Deutschland" von der Bevölkerungsmehrheit als
neue "Normalität" akzeptiert zu werden.«
»Die Herrschaft modernisiert sich auf allen Ebenen: Der Kapitalismus startet
durch und betreibt ein Rollback sozialer Absicherungen, das Patriarchat
propagiert den Backlash, Nationalismus und Rassismus scheinen ebenso wie
Militäreinsätze der "Weltmacht Deutschland" von der Bevölkerungsmehrheit als
neue "Normalität" akzeptiert zu werden.«
Das schrieb der HerausgeberInnenkreis der Zeitung Graswurzelrevolution im
Jahre 1997 als Ausgangssituation für eine Betrachtung libertärer Theorie und
Perspektiven zur Jahrhundertwende, zu der unter dem Titel »Anarchistischer
Herbst« vom 10.–12. Oktober 1997 ein Kongreß durchgeführt wurde. Rund 250
TeilnehmerInnen aus gewaltfreien und anarchistischen Gruppen sowie
LeserInnen der Zeitung Graswurzelrevolution trafen sich drei Tage in der Alten
Feuerwache Köln, um anläßlich des 25-jährigen Bestehens der
Graswurzelrevolution die Herausforderungen zu diskutieren, denen sich der
Anarchismus und insbesondere der gewaltfreie Anarchismus am Ende des 20.
Jahrhunderts stellen muß. Um möglichst weitgehende, auch transnationale
Anregungen zum Thema zu finden, wurden internationale Gäste eingeladen, die
am letzten Tag des Kongresses ihre Perspektiven darlegten. Die Texte dieses
Buches sind überarbeitete Diskussionsbeiträge dieses Kongresses.
Die Grobgliederung des Buches erinnert zwar noch an die Struktur des
Kongresses, hat aber allgemeineren Charakter: im ersten Teil ist eine erweiterte
Fassung des Einführungsreferates für den Kongreß zu finden, den zweiten Teil
des Buches bestreiten Beiträge einzelner AutorInnen, die in Vor- und
Nachbereitung oder aus den Diskussionen einzelner Arbeitsgruppen des
Kongresses entstanden sind, und den dritten Teil schließlich bestimmt die
Zusammenstellung der internationalen Beiträge. Dieser dritte Teil wird eröffnet
mit einer Erinnerung an den 1998 gestorbenen Altanarchisten Heinrich
Friedetzky, der auf dem Kongreß ein Grußwort sprach. Dadurch soll die durch
ihn verkörperte anarchistische Bewegung der zwanziger Jahre mit derjenigen
am Ende des Jahrhunderts symbolisch verbunden werden.
Nahezu alle Beiträge für dieses Buch sind kurz vor einem einschneidenden
Ereignis fertiggestellt worden: dem Krieg der NATO und der BRD gegen
Jugoslawien. Es ist allerdings kaum möglich, über anarchistische Perspektiven
für das 21. Jahrhundert nachzudenken, ohne die neue Führbarkeit
eines Krieges im letzten Jahr des alten Jahrhunderts zu reflektieren. Anstelle
eines ausführlichen Vorworts zu den vorliegenden Beiträgen des Buches soll
dies an dieser Stelle versucht werden.
Der Krieg gegen Jugoslawien: ein historischer Einschnitt
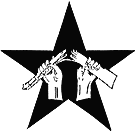 Für gewaltfreie AnarchistInnen stellt dieser Krieg einen historischen Einschnitt in
vielerlei Hinsicht, vor allem jedoch in seiner innenpolitischen Bedeutung dar:
zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, seit der Niederschlagung des
Nationalsozialismus und seiner Armee, der Wehrmacht, hat sich deutsches
Militär aktiv an einem Krieg gegen ein anderes Land beteiligt, mit dem
angegriffenen Serbien sogar erneut einen Feind definiert, der bereits zweimal
im abgelaufenen Jahrhundert Ziel deutscher Angriffe war. Die Herausforderung
Krieg – und direkt damit verbunden Vertreibung, Menschenrechtsverletzungen –
ist die größte Herausforderung, der sich die anarchistische Bewegung im
ausgehenden Jahrhundert gegenübersieht.
Für gewaltfreie AnarchistInnen stellt dieser Krieg einen historischen Einschnitt in
vielerlei Hinsicht, vor allem jedoch in seiner innenpolitischen Bedeutung dar:
zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, seit der Niederschlagung des
Nationalsozialismus und seiner Armee, der Wehrmacht, hat sich deutsches
Militär aktiv an einem Krieg gegen ein anderes Land beteiligt, mit dem
angegriffenen Serbien sogar erneut einen Feind definiert, der bereits zweimal
im abgelaufenen Jahrhundert Ziel deutscher Angriffe war. Die Herausforderung
Krieg – und direkt damit verbunden Vertreibung, Menschenrechtsverletzungen –
ist die größte Herausforderung, der sich die anarchistische Bewegung im
ausgehenden Jahrhundert gegenübersieht.
Und dies vorneweg: es reicht nicht und ist zudem zu bequem, während eines
Krieges oder danach über verpaßte Prävention und vertane Chancen
sogenannter »Konfliktlösungen« im Vorfeld zu lamentieren, wie dies einige
pazifistische Projekte oder WissenschaftlerInnen aus der Friedens- und
Konfliktforschung getan haben. Weder können auf diese Weise Kriege
verhindert werden noch wird damit in der Regel eine libertäre Kritik solcher
politikberaterischen Konzepte verbunden. So sind im Kriegsfall diejenigen fein
raus, die im Vorfeld der Kriege ihre Kräfte den Herrschenden andienten, anstatt
den Aufbau einer antimilitaristischen Bewegung voranzubringen. Von staatlicher
Subvention abhängige Konzepte wie etwa der »zivile Friedensdienst« werden
aber entweder in die Militärstrategie integriert oder in irgendwelchen
Ausschüssen geparkt, bis sie obsolet werden. Es ist schlichtweg zu billig, sich
dann im Kriegsfalle hinzustellen und zu sagen, die Alternativkonzepte hätten
vorgelegen, sie seien nur nicht verwirklicht worden. Daß und warum sie nicht
verwirklicht werden wollten, gehört zu den interessegeleiteten Ursachen des
Krieges, denen die professionalisierten InteressevertreterInnen
friedenspolitischer Konzepte allzuoft zu naiv gegenüberstehen. Ohne den
Aufbau einer breiten radikalpazifistischen und antimilitaristischen Bewegung
durch die kriegsgegnerischen Kräfte selber kann hier gar nichts bewirkt werden.
Protest und Widerstand gegen den Krieg, radikaler Antimilitarismus und
Anarchismus, auch ein aktivistischer Pazifismus sind aber historisch noch immer
eher Ausnahemerscheinungen. Gesellschaftliche Stimmungen gegen den Krieg,
gar kulturelle Hegemonien des Pazifismus wie in den achtziger Jahren müssen
über lange Phasen hinweg erkämpft werden und lassen sich nicht über Appelle
und Finanzanträge erreichen.
Gegen Unrecht oder vermeintliches Unrecht oder für eigene Interessen Gewalt
einzusetzen gilt heute eher wieder als Regel und erscheint den meisten
Menschen als legitim. Im allgemeinen Bewußtsein wird der Krieg als gerechte
Alternative zu Krieg und Menschenrechtsverletzungen empfunden, so wie der
Krieg gegen die Nazis als Ende der Lager und Beginn der Demokratie
interpretiert wird. Das war im Jugoslawien-Krieg eine zentrale
Rechtfertigungsideologie der Herrschenden. Vergessen oder noch gar nichts
ins öffentliche Bewußtsein vorgedrungen ist, daß der Krieg und seine Dynamik
zu einer Brutalisierung, Intensivierung und Modernisierung führten, durch die
das System Auschwitz überhaupt erst möglich geworden ist.1 Kaum bekannt ist,
daß die Logik des Krieges im Gegensatz zur Logik des zivilen Widerstandes
nicht auf die Rettung jüdischer Menschen oder auf die Bombardierung der
Gleise nach Auschwitz abzielte2, sondern auf eine weltweite Neuordnung
staatlicher Herrschaftsbereiche. Schließlich wird noch immer zu wenig über die
Tatsache reflektiert, daß der Befehl Hitlers zur Vernichtung der Juden/Jüdinnen
erst spät nach dem Angriff auf die Sowjetunion erteilt wurde und zu dieser Zeit
die militärische Niederlage bereits absehbar war.3 Mit diesen Relativierungen
soll nicht die Legitimität des historischen antinazistischen Krieges in Zweifel
gezogen, sondern nur der Kurzschluß hinterfragt werden, auf neuerlichen
Nazismus oder Vorstufen einer Vernichtungspolitik wie Vertreibung usw. könne
gar nicht anders als militärisch reagiert werden. Vor dem Hintergrund des
aktuellen Standes dieser geschichtspolitischen Diskussion sind Phänomene wie
während des zweiten Golfkrieges 1991 keineswegs Selbstverständlichkeiten, als
eine kriegsgegnerische Bewegung spontan massenhafte Ausmaße annahm und
im Ergebnis zumindest dafür sorgte, daß die BRD-Regierung und die
Bundeswehr die neunziger Jahre damit verbringen mußten, die eigene
Militärbeteiligung an solchen Kriegen der NATO minutiös mittels
Werbekampagnen, Oderdammbrucheinsätzen und einer ausgefeilten
»Salami-Taktik« langsam und Stück für Stück durchzusetzen. 1999 waren diese
Vorsichtsmaßnahmen gegen potentielle soziale Antikriegsströmungen im Innern
des Landes jedoch abgeschlossen. Den Herrschenden schien die Zeit reif,
erstmals mit Bundeswehreinheiten aktiv Krieg zu führen konnten. Der
Bürgerkrieg im Kosovo seit 1998, der NATO-Luftangriff, die Offensive der
jugoslawischen Armee und die Vertreibung von rund 780.000
Kosovo-AlbanerInnen, das Militärabkommen Mitte Juni und die Besetzung durch
NATO-Truppen, die Rache- und Vergeltungsaktionen der zurückkehrenden
Kosovo-AlbanerInnen und ihrer Guerilla UÇK, die Flucht der serbischen
Minderheit und der Roma aus dem Kosovo – all diese Kriegshandlungen und
-folgen spielten sich im wesentlichen ab, ohne daß sich innerhalb der BRD eine
ernstzunehmende soziale Bewegung gegen den Krieg entwickelt hätte, worauf
die existierenden gewaltfreien und/oder anarchistischen Gruppen hätten Einfluß
nehmen können.
Defizite und Perspektiven von Antikriegsstrategien
in den Metropolen
Es waren dabei nicht so sehr die praktischen Aktionsansätze gegen den Krieg,
die den radikal-antimilitaristischen Gruppen und den Graswurzelgruppen
fehlten. Potentiell wären sie vorhanden gewesen: weniger den postmodernen
Bedingungen westlicher Kriegsführung angemessen waren dabei eher
traditionelle Aufrufe zur Desertion, praktiziert wurden darüber hinaus aber auch
Blockaden und direkte gewaltfreie Aktionen gegen die militärische Infrastruktur
der kriegführenden Armeen, soweit sie direkt von der BRD aus mit der
Kriegsführung zusammenhingen.
Aufrufe zur Desertion erreichen immer weniger diejenigen Teile postmoderner
Armeen, die tatsächlich den Krieg führen – jene Berufssoldaten nämlich, die
geschützt vor eigener Verletzung oder Tod in unerreichbarer Höhe für den
Kriegsgegner ihre Bomben abwerfen. Nur deren Beeinflussung in den diversen
NATO-Armeen durch Desertionsaufrufe hätte unmittelbare Einwirkung auf das
Kriegsgeschehen versprochen. Noch beim zweiten Golfkrieg waren
Desertionsaufrufe keineswegs sinnlos, weil gleichzeitig eine riesige
Interventionsstreitmacht zusammengezogen und auch direkt im Krieg eingesetzt
wurde. Diese Soldaten waren zwar Berufssoldaten, aber keineswegs so
spezialisiert und durch Technik vom Gegner getrennt, daß Gefühle wie Angst
vor dem eigenen Tod kaum eine Rolle spielten. Viele US-Soldaten entzogen
sich damals dem Krieg durch Abwesenheit vom Dienst (»Absence without
leave«).
Diese Möglichkeit antimilitaristischer Agitation fehlte beim Krieg gegen
Jugoslawien völlig. Vielleicht sind die Soldaten von industriell-metropolitanen
Staaten von ihrer »humanitären« Mission sogar umso überzeugter, wenn auch
noch frühere PazifistInnen oder ehemals selbsternannte »Revolutionäre« wie
ein Außenminister Fischer den Krieg befürworten. Infolgedessen gingen
Desertionsaufrufe in den Metropolenarmeen ins Leere oder hatten rein
symbolischen Gehalt. Sie müssen für Strategien gegen die zukünftige
Kriegsführung allgemein überdacht werden. Schließlich wird sich die Aufteilung
der Bundeswehr in »Hauptverteidigungskräfte« und »Krisenreaktionskräfte«
vertiefen, letztere werden sich spezialisieren und fast ausschließlich aus
überzeugten Berufssoldaten zusammengesetzt werden, so daß sie immer
weniger durch traditionelle Aufrufe zur Kriegsdienstverweigerung erreicht
werden können.
Und weil das so ist, bekommen direkte gewaltfreie Aktionen von außen, die
gegen die militärische Infrastruktur der kriegführenden Armeen – auch in deren
Hinterland – gerichtet sind, zukünftig stärkere Bedeutung. Wo die innere
Struktur so festgezurrt ist, daß sie kaum noch beeinflußbar ist, bleibt nur der
soziale Angriff von außen: in dieser Hinsicht ließen sich Parallelen zur Situation
der etablierten und bürokratisierten ArbeiterInnenbewegung feststellen. Immer
öfter greifen Gewerkschaften aufgrund fester Strukturen im Innern bei
Arbeitskämpfen auf die Unterstützung von außen zurück. Als sich die
Angestellten der Drogeriekette Schlecker soziale Mindeststandards erkämpften,
wurde das Aktionsmittel VerbraucherInnenboykott von seiten der Gewerkschaft
in die Arbeitskampfstrategie miteinbezogen. Das erwies sich vor allem deshalb
als erfolgreich, weil am Beginn der Arbeitskämpfe die Schlecker-Belegschaft auf
Druck der Betriebsleitung gewerkschaftlich völlig unorganisiert war. Der Einsatz
von Boykottstrategien schält sich mindestens als Ergänzung, perspektivisch
vielleicht sogar als Hauptterrain von zukünftigen Arbeitskämpfen heraus. Seit
den antirassistischen BürgerInnenrechtskämpfen (Martin Luther King) haben
solche Aktionskonzepte in den USA eine lange Tradition und sind weit
verbreitet. Beim Kampf gegen den Ölkonzern Shell und die geplante
Versenkung der Ölbohrinsel Brent Spar hat die potentielle Macht des Boykotts
weltweit Aufmerksamkeit erregt. Auch für die Anti-AKW-Bewegung hat sich seit
ihren Anfangszeiten gezeigt, daß der soziale Angriff von außen auf die
Infrastruktur der Atomwirtschaft, von den Bauplatzbesetzungen bis zum
Widerstand gegen Atomtransporte, gerade dann erfolgversprechend sein kann,
wenn im Innenbereich der Atomanlagen, bei der Belegschaft, kaum oder
überhaupt kein Widerstandsgeist vorhanden ist.4
Diese Erfahrungen in anderen sozialen Bewegungen vorausgesetzt, war es
richtig von antimilitaristischen und gewaltfreien Aktionsgruppen, während des
Krieges gegen Jugoslawien überregionale Blockaden gegen Abflugbasen der
NATO-Bomber und zentrale Einrichtungen der Bundeswehr zu organisieren. Mit
diesen Aktionen sollte nicht nur die öffentliche Aufmerksamkeit darauf gelenkt
werden, daß dieser Krieg auch direkt von der BRD aus geführt wird, sondern
daß auch Eingriffsmöglichkeiten bestehen, mittels Blockaden oder
weitergehenden Aktionen wie Go-Ins oder Sabotage direkt Einfluß auf die
Kriegsführungsfähigkeit der NATO-Armeen, insbesondere der Bundeswehr zu
nehmen. Mit dieser Intention organisierten die noch aktiven Reste gewaltfreier
Aktionsgruppen überregionale Blockaden in Spangdalem bei Trier (von dieser
US-Basis flogen Tarnkappenbomber nach Jugoslawien), in Brüggen bei
Mönchengladbach (britische Tornado-Basis, ebenfalls direkte Bombereinsätze
gegen Jugoslawien), gegen das Verteidigungsministerium in Bonn, gegen das
Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr in Calw (bei eventuellem
Bodeneinsatz der Bundeswehr die erste Adresse) und gegen die US-Air-Base
Frankfurt (wichtiger Transportflughafen, von dem aus nachts
NATO-Tankflugzeuge zur Betankung der Bomber abflogen). Allein – im
Gegensatz zu 1991 lief diese Aktionsperspektive völlig ins Leere. Die paar
Hundert AktivistInnen aus dem engeren Bereich noch existierender gewaltfreier
Aktionsgruppen waren kein Vergleich zum Beispiel zu den Massenblockaden im
März 1997 im Wendland, als u.a. mit ca. 9.000 BlockiererInnen die
Legitimations- und Polizeieinsatzkosten für Atomtransporte so hoch getrieben
wurden, daß sie schließlich sogar ausgesetzt werden mußten. Weitaus wichtiger
als die Frage, welche Aktionsstrategien denn gegen die neuen Formen der
Kriegsführung angewandt werden könnten, wird also angesichts des
Jugoslawien-Krieges die Frage, warum bei einem Krieg, bei dem die
Bundeswehr erstmalig aktiv beteiligt war, keine relevante Antikriegsbewegung
entstand, obwohl sogar der traditionelle Anti-NATO-Reflex der
Friedensbewegung zum Teil noch funktioniert hat. Hier können äußere und
bewegungsinterne Faktoren angeführt werden, die sich gegenseitig verstärkten
und dahin ergänzten, daß sie alle zusammen die Menschen allenfalls in
Diskussionsveranstaltungen mit unterschiedlichen Meinungen und ungewissem
Ausgang und eben nicht auf die Straße trieben, wofür doch eine klare
Meinungsbildung und Entschiedenheit Voraussetzung ist.
Gründe der Antikriegsabstinenz
Was die äußeren Faktoren anbetrifft, so kann – auch wenn die Formulierung
abgedroschen klingt – zunächst einmal die fehlende Betroffenheit innerhalb der
Bevölkerung eine Rolle spielen, die – so irreal sie auch war – zumindest am
Anfang des zweiten Golfkrieges 1991 noch durchaus eine Rolle spielte. Damals
war spekuliert worden, daß sich der Krieg gegen den Irak zu einem
internationalen Bombenkrieg oder gar zu einem Dritten Weltkrieg ausweiten
könnte. Die Gefahr bestand auch am Anfang des Krieges gegen Jugoslawien –
ihre Wahrscheinlichkeit wurde jedoch weit geringer eingeschätzt als noch 1991.
Den Herrschenden ist es in den neunziger Jahren somit gelungen, trotz
allgegenwärtiger Mittelstreckenraketen und Atomwaffenpotentiale (die im
Jugoslawien-Krieg mittelbar durch die unklaren Reaktionen der Atommacht
Rußland eine Rolle spielten) Kriege als regional führbar und begrenzbar
darzustellen. Das beruhigt die Bevölkerung im eigenen Territorium und macht
sie eher geneigt, den Kriegszielen wenn nicht zuzustimmen, so doch nicht aktiv
gegen sie aufzubegehren. Diese von den Herrschenden erwünschte passive
Zustimmung der Bevölkerung in den Industrienationen macht Betroffenheiten
gegenüber den Greueln des Krieges steuerbar: während die herrschenden
Medien etwa die Dimension des Völkermords in Ruanda/ Burundi oder auch des
Krieges in Äthiopien/Eritrea erst im nachhinein dramatisierten oder überhaupt
herunterspielten, während die zuweilen einseitig hochgespielte Empörung über
islamistische Greuel in Algerien letztlich folgenlos blieb, konnten im früheren
Jugoslawien über Jahre hinweg mittels Greueln und Massakern wie »Sarajevo«,
»Srebrenica« usw. Betroffenheiten erzeugt, gesteuert und zudem sogenannte
»friedliche Konfliktlösungen« als gescheitert dargestellt werden. Unmittelbar
verschränkt mit der fehlenden oder für die Kriegszwecke steuerbaren
Betroffenheit ist das Bedürfnis der Mehrheit der Bevölkerung in den
Industriemetropolen, auch in Kriegszeiten einem konsumorientierten
Alltagsleben nachgehen zu können, welches alle psychischen und materiellen
Möglichkeiten der Verdrängung unangenehmer Realitäten zur Verfügung stellt,
die die postmoderne kapitalistische Gesellschaft zu bieten hat. Im Gegensatz zu
den großen Weltkriegen, die nicht zu Unrecht das ganze Jahrhundert hindurch
»moderne« Kriege genannt wurden, ist heute, in »postmodernen« Zeiten,
keineswegs mehr die ganze Gesellschaft einer Industrienation auf den Krieg
ausgerichtet: nicht nur die Wehrpflicht ist nicht unbedingt zur Kriegsführung
nötig, sondern es ist auch unnötig, das gesamte gesellschaftliche Leben auf
den Krieg hin auszurichten. Nur ein kleiner segmentierter Bereich der
Gesellschaft führt den Krieg, während die Mehrheit der Bevölkerung allenfalls in
passiver Zustimmung verharren soll.
Insbesondere der jüngeren Generation erscheint die künstlich-kapitalistische
Erlebniswelt, die ihnen die herrschende Gesellschaft vorgaukelt, wesentlich
attraktiver als ein selbstgewählter Weg in eine Minderheitenposition, in der man/
frau gegen ein ganzes System des Krieges vorgehen muß.
Im gesellschaftlichen Alltag zunehmender Deregulierung von Arbeits- und
Existenzpositionen werden traditionelle Männlichkeitsmerkmale
wiederaufgewertet: Manager und leitende Angestellte müssen nicht mehr, wie
noch in den achtziger Jahren, auf sogenannte »weibliche Werte« wie
Integrationsvermögen und den Ausgleich von Interessen bedacht sein, sondern
es zählen wieder Rücksichtslosigkeit im Vorgehen, Draufgängertum,
Mitleidlosigkeit. Auf der Seite der Erfolgreichen, der »Winner« zu stehen, wird
belohnt. Männliche Wertkategorien des Ausspielens von Machtpositionen,
Durchsetzungsfähigkeit in Konkurrenzpositionen, überhaupt Durchsetzung mit
Mitteln der Gewalt werden kultiviert und lassen sich mühelos in den Imperativen
des Krieges wiedererkennen. Mit diesen Tendenzen korrespondiert der
"Backlash" (Gegenschlag) der Männer gegen Inhalte und Errungenschaften der
Frauenbewegung und die Anpassung vieler Frauen an ihre wieder
zugewiesene, traditionelle Rolle: der Kampf um die Selbstbestimmung der Frau
(»Mein Bauch gehört mir !«) ist längst der freiwilligen Knechtschaft in einem
Beratungssystem gewichen, das von männlichen Juristen, Ärzten und
Kirchenvertretern beherrscht wird. Die familienorientierte, heterosexistische
Sozialpolitik auch der rot-grünen Regierung subventioniert Kinderreichtum und
die Rückkehr der Frau an Heim und Herd, vor allem unter den Bedingungen von
Deregulierung und zunehmender Frauenarmut. In den oft sexistischen
Songtexten und cool-machohaften Verhaltenskodexen subkultureller Szenen
von Hiphop über Gangsta-Rap, Industrial, »Rammstein«-Heavy Metal, Gothic bis
zu Techno, in Kinofilmen (von Heiner Lauterbach in Campus über Til Schweiger
und die deutsche Komödie bis hin zu Schwarzenegger und den
männlich-militaristischen "Sternenkriegen") kann ein kulturell-patriarchaler
"Backlash" festgestellt werden. Die kritische Männerforschung konstatiert einen
»konservativen Schwenk« bei Männergruppen und -initiativen seit Mitte der
neunziger Jahre: wo früher antisexistische Ansätze dominierten, setze sich heute
im Anschluß an die von Robert Bly inspirierten »Wilden Männer« eine
»pro-maskuline« Richtung durch, die auf der Basis einer behaupteten
biologischen Differenz zwischen Frauen und Männern gegen eine angebliche
»Feminisierung«, gleichgesetzt mit Verweichlichung, der Männer durch die
Frauenbewegung zu Felde zieht. Gefordert werden die Freilegung der
»verschütteten männlichen Energien« und »Männerrechte« – in völliger
Verkennung der Lage, wer gegenüber wem immer noch weitaus privilegierter ist.
Schuldzuweisungen werden von pro-maskulinen Männern verstärkt wieder an
Frauen gegeben, bis in Therapieansätze hinein. Antisexistische und
profeministische Männerforscher kritisieren, daß sich eine neue hegemoniale
Männlichkeit (»Marketplace Masculinity«) durchgesetzt habe, deren dominante
Attribute »Aggression« und »Konkurrenzkampf« seien 5 – Eigenschaften, die
auch eine moderne metropolitane Kriegsführung braucht.
Die Hoffnungen, die viele Menschen jahrelang in einen Regierungswechsel
gesteckt hatten, wurden durch die Kriegsbeteiligung der Rot-Grünen zwar
enttäuscht, entscheidender war aber, daß mit der Wahlstimme immer auch ein
Stück Urteilsfähigkeit und Verantwortlichkeit für’s Handeln an die
Regierungsparteien weitergegeben wurde und dadurch die Bindung des
Bewußtseins der rot-grünen WählerInnen an die Diskussionen ihrer Parteien
sehr stark war. So lebten die Grünen ihren WählerInnen die
ohnmachtsgebietende, selbstquälerische »Zerrissenheit« in ihrer
Regierungsfunktion beispielhaft vor – und waren doch gleichzeitig TäterInnen.
Für das an Rot-Grün gebundene alternative Bewußtsein ihrer WählerInnen
bedeutete das einen Blick in den Abgrund, sofern sie ihre Loyalität ans
rot-grüne Milieu beendet hätten: auch biographisch wollen die
Grün-WählerInnen nicht noch einmal völlig von vorn anfangen, als Minderheit
ohne unmittelbare Perspektive gesellschaftlicher Aufmerksamkeit und Relevanz.
Deshalb sind sie geneigt zu vergessen, daß mit der grünen
Regierungsbeteiligung von den ursprünglichen Zielen nicht nur nichts erreicht
worden ist, sondern sich die Ziele in ihr Gegenteil verkehrt haben und die
Grünen mittlerweile selbst Teil des Problems, das heißt des Systems, geworden
sind. Dieser psychische Mechanismus derjenigen, die mit den Grünen alt
geworden sind, dieses »nicht noch einmal von Null anfangen wollen« (was ja
auch gleichzeitig bedeutet, über Jahrzehnte hinweg alles falsch gemacht zu
haben, wer gesteht sich das schon gerne ein ?) – das wirkt als psychische
Barriere gegen jeglichen Gedanken an neuerlichen, beschwerlichen Protest und
Widerstand.
So kam es ohne eine breite Antikriegsbewegung, ohne sozialen
Resonanzboden für gewaltfreie und anarchistische Aktionsansätze dazu, daß
die PDS (Partei des Demokratischen Sozialismus) den Vertrauensbruch der
Grünen nahezu unmittelbar nutzen konnte, obwohl doch mit der
Kriegsbeteiligung der Grünen für Libertäre offensichtlich das beste Argument
gegen parlamentarische Politik zum Tragen hätte kommen müssen. In einer
Situation, in welcher die Gegenaktivitäten jedoch nicht von einer spontan
entstandenen sozialen Bewegung ausgehen, sondern eher von bereits
organisierten Gruppierungen geprägt werden, werden aber auch die
ideologischen Debatten rigider geführt und prallen deutlicher als sonst
aufeinander. Dies führte zu ungemein widersprüchlichen Außendarstellungen
der verbliebenen Antikriegsinitiativen, die sich in der Frage, ob und wie gegen
den Krieg protestierende serbische NationalistInnen integriert werden sollten,
oder auch bei der Frage, ob und wie die Vertreibungspolitik Milosevics
thematisiert werden darf, entweder völlig zerstritten oder diese Diskussion
zumindest nicht befriedigend zu einem Ende führen konnten. Ergebnis war
vielerorts ein problematisches Bild der Antikriegsbewegung, welches die Medien
noch dazu in manchen Fällen als gewollten Schulterschluß der
KriegsgegnerInnen mit serbischen NationalistInnen diffamierten. Daß dieser
Eindruck, verbunden mit der auch tatsächlich oft genug ungenügenden
Behandlung der Vertreibungsthematik in von autoritär-linken Organisationen
dominierten Antikriegsbündnissen, potentielle KriegsgegnerInnen aus
bürgerlichen Kreisen oder enttäuschte Grünen-WählerInnen davon abhielt, den
Schritt auf die Straße zu machen, liegt auf der Hand – wenngleich das nicht
entscheidend für die zahlenmäßig geringe Stärke der KriegsgegnerInnen
gewesen sein dürfte.
Ein weitaus gewichtigerer Grund für die weitgehende Kriegszustimmung als
diese internen, den binnenorganisatorischen Zustand der Antikriegsbündnisse
betreffenden Überlegungen ist zweifellos der zunehmende Nationalismus
innerhalb der BRD, der sich in den Köpfen großer Teile der Bevölkerung auf
verschiedene Weise widerspiegelt. Zum Beispiel als Bereitschaft, sich selbst als
Teil einer ordnungschaffenden neuen Weltmacht zu betrachten, noch dazu mit
dem beruhigenden Gefühl, im Gegensatz zur Nazi-Zeit diesmal auf der Seite
sowohl der »Richtigen« wie der Sieger zu stehen, oder sich mindestens nicht
vorstellen zu können, daß auch die BRD wie jeder Nationalstaat dazu in der
Lage ist, imperialistische Interessenpolitik mit humanitären Motiven nur
ideologisch zu bemänteln. Wenn in mancher Beziehung die Situation der
Friedensbewegung der achtziger Jahre, so kritikwürdig sie in vielen Punkten
sein mag, mit der jetzigen Situation verglichen wird, wird die Veränderung
offenbar: die Denkweise großer Teile der Bevölkerung ist in den neunziger
Jahren, genauer gesagt seit der Vereinigung 1990 zur neuen Weltmacht
Deutschland, umgekehrt worden. In den achtziger Jahren konnten Gewaltfreie
und Libertäre noch von
einem tendenziell pazifistischen Grundkonsens ausgehen. »Stell dir vor, es ist
Krieg und keiner geht hin!« war als Utopie so verbreitet, daß ein den
jugoslawischen Guerilla-Krieg mythologisierendes Buch von Paul Parin über
seine Kriegsbeteiligung bei den Tito-Partisanen unter dem Titel »Stell dir vor, es
ist Krieg, und wir gehen hin !« noch wie eine Provokation behandelt wurde. Die
Grundsätze »Nie wieder Faschismus ! Nie wieder Krieg !« wurden als
gleichberechtigt und sich gegenseitig bedingend angesehen.
Konsequenterweise führte Heiner Geißlers Satz, der Pazifismus habe Auschwitz
überhaupt erst möglich gemacht, noch zum Skandal, für den nicht die
Friedensbewegung, sondern Geißler sich rechtfertigen mußte. Geißlers Diktum
gilt dagegen heute als common sense und die Gegeneinanderstellung der
beiden Grundsätze »Nie wieder Krieg !« und »Nie wieder Auschwitz !« gehörte
zu den zentralen ideologischen Legitimationsmustern des Krieges gegen
Jugoslawien, ausgesprochen durch Außenminister Fischer. Daß die realen
Opfer des Nationalsozialismus, SerbInnen und Roma, nach dem Einmarsch der
NATO aus dem Kosovo mit passiver Zustimmung der NATO-Armeen oder
mindestens ohne konsequente Gegenwehr vertrieben wurden, ist ein
Treppenwitz dieser ideologischen Kriegsrechtfertigungsgeschichte.
Auch die weithin geteilte, im wesentlichen blockübergreifende, tendenziell
neutralistische Tendenz damals wurde in den neunziger Jahren von den
Herrschenden erfolgreich immer wieder als »Sonderweg« diffamiert und als
solcher in Beziehung zum nationalsozialistischen »Sonderweg« gesetzt – eine
ganz absurde historische Parallelisierung. Während der »Sonderweg« der Nazis
beispielsweise tatsächlich zum Austritt aus dem Völkerbund führte, umfaßte die
Blockfreienbewegung während des Kalten Krieges immerhin die Mehrheit aller
UN-Mitglieder. Wenngleich die neutralistische Tendenz im Sinne einer
Staatenpolitik (etwa bei der von kommunistischen Gruppen propagierten
Forderung »BRD raus aus der NATO« im Gegensatz zur
gewaltfrei-anarchistischen Forderung »Auflösung der Militärblöcke«)
keineswegs frei von nationalistischen Gefahren und insofern tatsächlich ein
Einstiegstor für rechtsextreme Gruppen war, so war diese Gefahr trotzdem
bekämpfbar: die blockübergreifende, neutralistische Tendenz umfaßte immer
gleichzeitig die Ablehnung einer Weltmachtrolle der BRD und über diese
defensive Einstellung blieb die Möglichkeit einer kulturellen Hegemonie
antimilitaristischer und pazifistischer Gruppen über rechte Gefahren einer
Instrumentalisierung erhalten. Heute jedoch, mit der Emanzipation der
vereinigten Weltmacht BRD innerhalb der NATO, die sich nun nicht mehr nur
diplomatisch wie noch Anfang der neunziger Jahre mit der Anerkennungspolitik
gegenüber Kroatien und Slowenien, sondern auch militärisch vollzieht, bedeutet
Schröders Rede von einer Ablehnung eines »Sonderwegs« gerade diesen:
einen nationalistischen Sonderweg Deutschlands zur wirtschaftlichen,
politischen und militärischen Weltmacht. Die zweite oder dritte Rangstellung
innerhalb der NATO, einer Spezialorganisation, der auch nach der
Osterweiterung nur 19 Nationalstaaten der Welt angehören, ist in jeder
Beziehung ein »Sonderweg«, vor allem im Vergleich mit allen anderen
UN-Mitgliedsstaaten. Doch die Absurdität der Rede von der
»Staatengemeinschaft«, innerhalb derer sich die BRD nun unwiderruflich
befände, wird von einer Öffentlichkeit nicht mehr durchschaut, die den Staat im
Kopf trägt. Was bleibt ist ein weithin getragenes Gefühl der Berechtigung der
BRD zur weltpolitischen Rolle einer Ordnungsmacht. In diesem nationalen
Selbstbewußtsein einer Weltordnungsmacht gedeiht neuer Rechtsextremismus
ganz von selbst, und zwar völlig gleichgültig davon, ob rechtsextreme Parteien
nun für oder gegen den Krieg eintreten: jede stolzgeschwellte Brust nach einem
militärisch erfolgreichen Einsatz der Bundeswehr ist eine potentielle
Nachwuchskraft für die Rechtsextremen, so daß befürchtet werden muß, daß
mit den Weltmachtambitionen der BRD auch der innenpolitische
Rechtsextremismus ansteigen wird.
Schon jetzt, nach dem Krieg, können kulturelle Errungenschaften des radikalen
Antimilitarismus kaum noch so selbstbewußt vorgetragen werden wie vorher:
deutsche Soldaten sind nun zwar, wie immer prognostiziert, ganz real zu
Mördern geworden, die Aussage »Soldaten sind Mörder !« wird bei
Rekrutengelöbnissen gleichwohl schwieriger öffentlichkeitswirksam vorgetragen
werden können, das Abseitige und Minoritäre der »Störer« dagegen in den
Medienberichten eher herausgestellt. Die rechtsextremen Affinitäten vieler
Rekruten der Bundeswehr werden zukünftig wieder stärker verharmlost werden.
Und auch die unmittelbare Verbindung von Kriegsführung mit Verbrechen,
deren Thematisierung in der Ausstellung zu den Verbrechen der Wehrmacht
weite Teile der Bevölkerung erreichte, wird kaum als Argument gegen
kommende Kriege der Bundeswehr taugen (was von den Machern offenbar
auch gar nicht beabsichtigt war), sondern eher rückblickend auf die spezielle
Armee »Wehrmacht« beschränkt reflektiert werden. Gleichzeitig können sich
viele Menschen kaum noch vorstellen, daß die BRD in solchen Kriegen andere
als rein menschenrechtliche, im Grunde altruistische Interessen haben könnte.
Die Gefahr, daß die militärische Emanzipation der BRD innerhalb der NATO
dazu dienen könnte, dereinst auch innerhalb einer von der BRD kontrollierten
europäischen Armee – oder gar einseitig national – militärische Alleingänge
durchzuführen, wird von einem solchermaßen konditionierten Bewußtsein
überhaupt nicht wahrgenommen.
Vordringliche Aufgabe: Schaffung einer neuen
libertären Kultur
So sieht eine knappe Skizze der gesellschaftlichen Ausgangsbedingungen für
die Herausforderung Krieg aus, der sich gewaltfreie, antimilitaristische und
anarchistische Gruppierungen in der BRD am Ausgang des alten Jahrhunderts
gegenüber sehen. Der hier notwendige Realismus der Lageeinschätzung muß
jedoch nicht in Hoffnungslosigkeit münden. Daß bei diesem historischen
Einschnitt einer erstmaligen Bundeswehrbeteiligung an einem Krieg der NATO
keine soziale Protestbewegung entstand, muß nicht bedeuten, daß dies nun
immer so sein wird. Jede Dynamik, jeder Einschnitt innerhalb des Krieges hätte
Brüche entstehen lassen können, anhand derer Protestpotential hätte aktiv
werden können: schon die Beteiligung der Bundeswehr an einem eventuellen
Bodenkrieg hätte ein solcher Bruch sein können. Die Desillusionierung über die
rot-grüne Regierungspolitik ist noch nicht in direkte Aktion umgeschlagen, ihr
reales Vorhandensein und die Abkehr vieler von offizieller Politik, die noch vor
dem Krieg einige Hoffnungen in die rot-grüne Regierung setzten, ist jedoch
kaum zu bestreiten. Die Entstehungsbedingungen sozialen Widerstands sind
unabsehbar und kaum prognostizierbar – was sicher von Vorteil ist, denn
dadurch sind auch herrschaftliche Kontroll- und Präventionsstrategien prinzipiell
auch nur beschränkt wirksam, so sehr sie beim Jugoslawien-Krieg auch
gegriffen haben mögen.
Was die Ausgangsposition für gewaltfreie, radikal-antimilitaristische,
antisexistische und anarchistische Gruppen nach diesem Krieg so schwierig
macht, ist das Fehlen einer tragfähigen libertären Kultur in der BRD. Zwar
entstand nach 1968 ein über mehrere Jahrzehnte tragfähiges alternatives, in
großen Teilen libertäres Milieu, doch die mit ihr in Verbindung stehende
anarchistische Bewegung war immer auf wenige Gruppen, Organisationen und
Zeitungen mit begrenzter Breitenwirkung beschränkt. Auf diese Weise konnte
selbst zu Hochzeiten libertär und gewaltfrei beeinflußter sozialer Bewegungen in
den siebziger und achtziger Jahren, insbesondere der Anti-AKW-Bewegung,
keine mit der libertären Tradition etwa Frankreichs oder Spaniens vergleichbare
anarchistische Kultur entstehen. Das Wissen um Geschichte, Utopien, reale
Möglichkeiten und Erfahrungen der anarchistischen Tradition ist im deutschen
Sprachraum noch heute kaum verbreitet. Ohne libertäre Kultur ist jedoch jede
soziale Bewegung dazu verurteilt, autoritären Losungen zu folgen oder
Integrationsdynamiken durchzumachen, wie das die Massenbewegung in der
DDR nach 1989 in rasendem Tempo als Vereinigungsprozeß erfahren hat.
Ohne eine Grundlegung durch libertäre Kultur lassen sich auch freiheitliche
Errungenschaften sozialer Bewegungen wie der Frauen-, der Ökologie- oder
der Friedensbewegung nicht auf Dauer sozial, das heißt in den Denk- und
Verhaltensweisen der Menschen, stabilisieren. Ohne libertäre Kultur schließlich
lassen sich innerhalb sozialer Gegenbewegungen auch nicht dauerhaft Dämme
gegen nationalistische Tendenzen errichten.
»Anarchie« hieß nach dem Krieg gegen Jugoslawien für die meisten Menschen
im deutschsprachigen Raum ein Zustand im Kosovo direkt nach dem Einrücken
der NATO-Armeen, in welchem die serbische Minderheit und die
Roma-Minderheit Freiwild der Rache nehmenden UÇK-Kämpfer oder
zurückkehrender Kosovo-AlbanerInnen war. »Anarchie« wurde von den
herrschenden Medien erfolgreich ein Zustand genannt, der das gegenseitige
Morden und Vertreiben aufgrund fehlender Justiz-, Gefängnis- und
Polizeieinheiten beschrieb. Dabei war diese »Anarchie« genannte Situation
nichts anderes als voll und ganz Ergebnis staatlicher und militärischer
Kriegspolitik. Diese vollkommene Verdrehung jedes Verständnisses von
Anarchismus im Alltagsbewußtsein muß zum Ausgangspunkt einer
Neuformulierung anarchistischer Bewegung zu Beginn des 21. Jahrhunderts
werden.
Die pazifistischen, gewaltfreien und anarchistischen Gruppen stehen also
wieder ganz am Anfang, was die Ausgangsbedingungen betrifft. Sie stehen
allerdings nicht am Anfang, was den Erfahrungsschatz betrifft, den ihre sozialen
Kämpfe in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts angehäuft haben. Von
diesem Erfahrungsschatz zehrend müssen Begriffe wie »Krieg« auf ihre
Gewaltförmigkeit hin wieder öffentlich denunziert werden: in den neunziger
Jahren sind die Kategorien Krieg und Verbrechen systematisch getrennt
worden. Um Krieg wieder führbar zu machen, wurde alles Negative von ihm
genommen und ihm gegenübergestellt: »ethnische Säuberung«,
»Vergewaltigung« (das angebliche Besitz»Recht« der Männer siegreicher
Armeen), schließlich Vertreibung wie im Kosovo-Krieg. Der Krieg gerät auf diese
Weise in einen Nimbus der Reinheit und Harmlosigkeit, der jeder Beschreibung
spottet. Schließlich wurde er von BuchautorInnen wie zum Beispiel Cora
Stephan gar als simples »Handwerk« beschrieben.6
Nur vor diesem ideologischen Hintergrund erscheint der Krieg als
handhabbares Mittel der Politik und der Diplomatie, als neutrales Werkzeug, das
eingesetzt werden kann oder auch nicht – selbstredend nur zu »guten«
Zwecken. Hier glichen sich die Inhaber der Staatsgewalt und die bewaffneten
»RevolutionärInnen« schon immer in ihrer Ideologie vom »gerechten Krieg«.
Und insofern verstehen sich auch Leute wie Fischer, Trittin, Bütikofer als
konsequent und legitimeren mit dieser Ideologie ihr Selbstverständnis, vor sich
und vor ihrer eigenen Biographie. Jedem prinzipiellen Kriegswiderstand wird so
der Garaus gemacht. Wenn dann die Brutalitäten des Krieges offenbar werden,
ertönt der kollektive Schrei der Bevölkerung nach einer »Rückkehr zur Politik« –
und bleibt so doch völlig in staatlichem Rahmen und im Rahmen der Kriegsziele.
Aufgabe einer gewaltfrei-anarchistischen Kultur wäre es hingegen, Staat und
Krieg in ihrer gegenseitigen Bedingtheit zu sehen, alle Staaten und jede
Staatspolitik als notwendigerweise zu Kriegen tendierend zu beschreiben und
den Krieg prinzipiell als das Verbrechen zu denunzieren, das alle anderen
Kriegsverbrechen schon miteinschließt. Schon um zu existieren definiert der
Staat ein Territorium, innerhalb dessen er das Monopol aller Gewaltausübung
beansprucht. Um dieses Monopol als Herrschaft gegen alle oder große Teile
der Bevölkerung durchzusetzen, ist zunächst die Armee, später die Polizei
geschaffen worden. Kein Staat kann auf Dauer ohne Armee existieren, die BRD
nach dem Zweiten Weltkrieg ist das beste Beispiel dafür. Meist entstehen
Staaten erst durch Kriege, separatistische Armeen sind im Kern vorstaatliche
Organisationen – wofür die Genese der neuen Nationalstaaten im Süden
Rußlands nach 1989 oder der neuen Staaten in Ex-Jugoslawien eine Fülle an
Anschauungsmaterial bieten. Jeder Staat existiert durch Abgrenzung gegen
andere Staaten, wendet sich gegen andere Staaten und bildet dafür die
Ideologie des Nationalismus aus. Jede Armee tendiert dazu, eingesetzt zu
werden. Nationalistische Staatspolitik führt daher mit Notwendigkeit zur
Benutzung des staatlichen Mittels Militär, um eigene Interessen gegen die
Interessen anderer Staaten durchzusetzen. Das ist der innere Zusammenhang
von Staat und Krieg.7 Dabei kann nicht übersehen werden, daß nicht nur die
BRD auf der Welt Kriege führt, und daß unter der Maßgabe der Denunziation
deutscher Kriegsinteressen die Frage berechtigt ist, wie denn die Bürgerkriege
auf dieser Welt beendet werden können. Dem eher völkerrechtlichen Prinzip
»Kein Staat darf gegen einen anderen Krieg führen« – eine Unmöglichkeit, weil
bereits die Existenz von Staaten den Krieg gegeneinander bedingt –, muß in
jedem Fall das anarchistische Prinzip »Kein Staat hat ein Recht zur
Unterdrückung seiner eigenen Bevölkerung« beiseite gestellt werden, um den
Widerstand gegen NATO-Krieg und -Intervention nicht ins Fahrwasser falscher
und blutiger Solidarität zu rücken. Wichtig ist hier gerade von anarchistischer
Seite aus, den Gegner der NATO, in diesem Fall wahlweise den Staat
Jugoslawien oder den serbischen Nationalismus, weder zu verteidigen noch ihn
in Formen eines negativen Nationalismus als monolithischen Block
wahrzunehmen und damit nur die westliche Sicht der Medien zu reproduzieren,
sondern als differenzierte Gesellschaft, in der auch weniger oder mehr
antikriegerische und nichtnationalistische Ansätze vorhanden sind. Immerhin
widerstanden die Belgrader »Frauen in Schwarz« die ganzen neunziger Jahre
hindurch jeglichem nationalistischen Druck, protestierten gegen alle serbischen
Kriege und unterstützten Deserteure aus allen kriegführenden Staaten. Große
Teile der serbischen und jugoslawischen Bevölkerung entzogen sich dem Militär
und desertierten, die Schätzungen gehen bis 1995 bis hin zu 300.000
Menschen, die sich den Rekrutierungen und Offensiven der jugoslawischen
Armee entzogen. Auch im Kosovo-Krieg war die Zahl der Rekrutenverweigerung
enorm.8 Das ist keine Garantie gegen die Durchführung von Vertreibungen,
doch die Desertion ist in Bürgerkriegen ein nicht zu vernachlässigender sozialer
Machtfaktor. Dabei brauchen die Motive für Desertion oder die Senkung der
Kampfmoral nicht immer ethisch begründet zu sein: in den durch großangelegte
Plünderungen gekennzeichneten Bürgerkriegen zerstörter und ruinierter
Ökonomien der neunziger Jahre9 gab es auch vielerlei Formen der
Soldatenmeutereien aufgrund ausbleibender oder zu geringer Bezahlung der
Soldaten. Zusammen mit ethisch begründeten Verweigerungen, den Initiativen
von Soldatenmüttern – die in Kriegen immer wieder eine Rolle spielen –, und
diesen eher materiell begründeten Desertionen spielt die
Kriegsdienstverweigerung in eher mit vormodernen Mitteln geführten
Bürgerkriegen nach wie vor eine entscheidende Rolle, ganz im Gegensatz zu
den postmodern geführten Technokriegen der kapitalistischen
Metropolenstaaten.
Die solidarische Unterstützung von DeserteurInnen in Kriegsgebieten hat sicher
ihre Grenzen und es ist fraglich, ob mit dieser Form der Solidarität die brutalen
Vertreibungen des jugoslawischen Staates verhindert worden wären. Wenn hier
die Grenzen gewaltfrei-anarchistischer Strategien eingeräumt werden, müssen
allerdings gleichzeitig die angeblichen »Erfolge« der
militaristisch-nationalistischen Strategien denunziert werden: die
NATO-Bombardements haben sicher zur Legitimierung und Intensivierung der
Vertreibungen in den ersten Wochen und zur Schaffung einer
serbisch-nationalistischen Front in Jugoslawien beigetragen, und die in den
Kosovo nach den Bombardements eingerückten NATO-Armeen konnten oder
wollten die Vertreibung der serbischen Minderheit und der Roma durch die
zurückgekehrten AlbanerInnen nicht verhindern. Das Ergebnis der militärischen
»Konfliktlösung« war in jedem Fall nationalistisch und ein Desaster: entweder
ein serbischer Kosovo ohne Kosovo-AlbanerInnen oder ein albanischer Kosovo
ohne SerbInnen und andere Minderheiten. Angesichts dieser militärischen
»Erfolge« sind die Grenzen gewaltfrei-anarchistischer Strategien allerdings
leichter zu verkraften.
Bei einer Rundreise serbischer Kriegsdienstverweigerer während des Krieges
gegen Jugoslawien sprach einer der serbischen Antimilitaristen in einem
privaten Gespräch mit örtlichen GraswurzelrevolutionärInnen mit Begeisterung
von der massenhaften Oppositionsbewegung gegen Milosevic in Belgrad im
Jahre 1997. Die antinationalistischen und kriegsgegnerischen Gruppen
Belgrads hätten seiner Meinung nach einigen Einfluß auf den Charakter (viel
Witz, Musik und Spaß innerhalb des Widerstands) und die Verlaufsform (eher
gewaltfrei) des Widerstands gehabt. Und dann erzählte er von einer
Demonstration mit mindestens 300.000 SerbInnen im Stadtzentrum Belgrads,
bei der gerade die Meldung eintraf, daß am selben Tag im Belgrader Gefängnis
ein Kosovo-Albaner von serbischer Polizei zu Tode geprügelt worden war. Als
das den 300.000 Demonstrierenden mitgeteilt worden war, riefen Redner zu
einer Schweigeminute für den ermordeten Kosovo-Albaner auf – und 300.000
SerbInnen schwiegen in Belgrad im Gedenken an einen Kosovo-Albaner ! Das
war 1997 noch möglich. Und dieser Einfluß nichtnationalistischer Gruppen auf
die serbische Opposition, ihre direkten Kontakte mit Kosovo-AlbanerInnen, ist
mit den NATO-Bomben zerstört worden. Das war der Grund für ihren
Widerstand gegen die NATO-Bombardements. Es sind nun auch gerade die
nicht-nationalistischen Oppositionsgruppen, die sich am schwersten von den
Rückschlägen des Krieges erholen können. Es ist damit zu rechnen, daß diese
von ihnen mit beeinflußte solidarische Verhaltensweise vieler SerbInnen mit
Kosovo-AlbanerInnen auf Jahrzehnte hinaus zerstört und zerbombt ist. Im
übrigen und als Hinweis für die Antikriegsinitiativen innerhalb der BRD: gerade
die serbischen Exilgemeinden in der BRD sind von den serbischen radikalen
Antimilitaristen auf ihrer Rundreise als am stärksten nationalistisch, zum größten
Teil nationalistischer als die SerbInnen in Jugoslawien selber, beschrieben
worden. Diese Antimilitaristen und Nationalismuskritiker sind auch während der
Rundreise von serbischen NATO-GegnerInnen als »Vaterlandsverräter«
bezeichnet und sogar körperlich bedroht worden – ein Grund mehr, nicht
einfach »den« jugoslawischen Staat gegen die NATO-Angriffe zu verteidigen.
Nicht einem Staat gehört libertäre Solidarität, sondern immer bestimmten
Strömungen, Gruppen, Menschen. Nur so lassen sich Nationalismen
bekämpfen.10
 Es ist Aufgabe libertärer Kultur und auch der anarchistischen Zeitungen wie zum
Beispiel der Zeitung Graswurzelrevolution, über solche libertäre, gewaltfreie,
nichtnationalistische Minderheitengruppen wie diese Belgrader
Kriegsdienstverweigerer oder die »Frauen in Schwarz« zu berichten, sie
bekannt zu machen, sie zu unterstützen. Der Krieg gegen Jugoslawien zeigte,
daß in den herrschenden Medien und in der bürgerlichen Presse über diese
Gruppen nicht berichtet wurde. Nur das politische Überleben solcher Gruppen
und die Perspektive der Verbreiterung ihres Einflusses birgt in sich die Chance
zu einer gewaltfreien, libertären, nichtnationalistischen und weder von Haß noch
Rache gezeichneten gesellschaftlichen Zukunft im 21. Jahrhundert, hier wie in
Jugoslawien. Darin liegt die Aufgabe libertärer Gruppen und Medien: libertäre
und gewaltfreie Kultur zu verbreiten und für Gegenöffentlichkeit zu sorgen,
gerade vor und in Zeiten des Krieges.
Es ist Aufgabe libertärer Kultur und auch der anarchistischen Zeitungen wie zum
Beispiel der Zeitung Graswurzelrevolution, über solche libertäre, gewaltfreie,
nichtnationalistische Minderheitengruppen wie diese Belgrader
Kriegsdienstverweigerer oder die »Frauen in Schwarz« zu berichten, sie
bekannt zu machen, sie zu unterstützen. Der Krieg gegen Jugoslawien zeigte,
daß in den herrschenden Medien und in der bürgerlichen Presse über diese
Gruppen nicht berichtet wurde. Nur das politische Überleben solcher Gruppen
und die Perspektive der Verbreiterung ihres Einflusses birgt in sich die Chance
zu einer gewaltfreien, libertären, nichtnationalistischen und weder von Haß noch
Rache gezeichneten gesellschaftlichen Zukunft im 21. Jahrhundert, hier wie in
Jugoslawien. Darin liegt die Aufgabe libertärer Gruppen und Medien: libertäre
und gewaltfreie Kultur zu verbreiten und für Gegenöffentlichkeit zu sorgen,
gerade vor und in Zeiten des Krieges.
Harold the Barrel

Anmerkungen
- 1 Vgl. dazu Zygmunt Bauman: Dialektik der Ordnung. Die Moderne und der
Holocaust, Hamburg 1992
- 2 Vgl. Jaques Semelin: Ohne Waffen gegen Hitler. Eine Studie zum zivilen
Widerstand in Europa, Frankfurt/M. 1995
- 3 Vgl. zum Zeitpunkt der Entscheidung und den daraus zu ziehenden
Schlußfolgerungen Philippe Burrin: Hitler und die Juden. Die Entscheidung für
den Völkermord, Frankfurt/M. 1993
- 4 Viele Erfahrungen mit Boykottstrategien in Arbeitskämpfen haben
MitarbeiterInnen der Werkstatt für gewaltfreie Aktion Baden gesammelt,
Informationen zu bestellen über: Uli Wohland, c/o Werkstatt für gewaltfreie
Aktion, Baden, Karlstor 1, 69117 Heidelberg
- 5 Vgl. Peter Döge: Die Erforschung der Männlichkeit. Neue wissenschaftliche
Ansätze in der Debatte über Geschlechterdemokratie und was Männer dazu
beitragen können, in: Frankfurter Rundschau, 31.7.99, S. 9
- 6 Vgl. die Kritik: Modernisierung des gerechten Krieges.
Cora Stephan propagiert den Krieg als »Handwerk«,
in GWR 236, S. 3
- 7 In der GWR wurde dieser Zusammenhang mehrfach dargelegt, ausführlich
vgl. auch Knut Krusewitz: Statt und Krieg in: Wege des Ungehorsams, Jahrbuch
I für gewaltfreie & libertäre Aktion, Politik und Kultur, Kassel 1984
- 8 Vgl. Rudi Friedrich, Connection e.V.: Jugoslawien: Desertion und
Kriegsdienstverweigerung. Informationsblatt anläßlich der Rundreise von Darko
Kovacev und Bojan Aleksov, 29.5.99.
- 9 Vgl. dazu detailliert François Jean, Jean-Christophe Rufin (Hrsg.): Ökonomie
der Bürgerkriege, Hamburg 1999 und auch Ernst Lohoff: Der Dritte Weg in den
Bürgerkrieg. Jugoslawien und das Ende der nachholenden Modernisierung.
Bad Honneff 1996
- 10 Genau dies, die Solidarität mit dem jugoslawischen Staat, forderten aber
sogar selbst erklärte »Antinationalisten« wie etwa Konkret-Redakteur Jürgen
Elsässer. Sie beschrieben die antinationalistische Kritik auch an serbischen
NationalistInnen während der Antikriegsaktionen als »Antinationalismus der
dummen Kerls«, z.B. im Konkret-Streitgespräch in: Nr. 7/99.
M. E. ist Elsässer daher kein Antinationalist, sondern nur ein »dummer Kerl«.
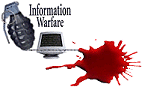
|

